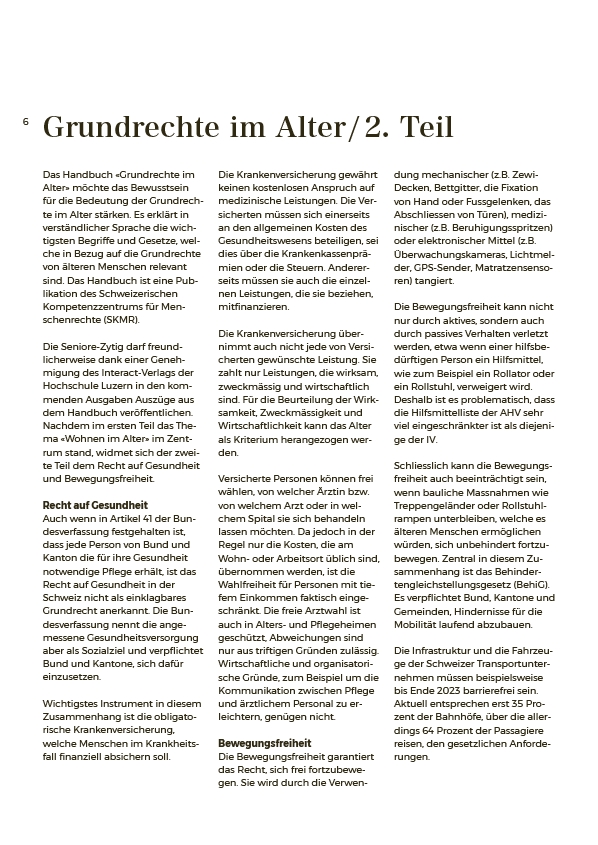
6
Grundrechte im Alter / 2. Teil
Das Handbuch «Grundrechte im
Alter» möchte das Bewusstsein
für die Bedeutung der Grundrechte
im Alter stärken. Es erklärt in
verständlicher Sprache die wichtigsten
Begriffe und Gesetze, welche
in Bezug auf die Grundrechte
von älteren Menschen relevant
sind. Das Handbuch ist eine Pub-
likation des Schweizerischen
Kompetenzzentrums für Menschenrechte
(SKMR).
Die Seniore-Zytig darf freund-
licherweise dank einer Geneh-
migung des Interact-Verlags der
Hochschule Luzern in den kommenden
Ausgaben Auszüge aus
dem Handbuch veröffentlichen.
Nachdem im ersten Teil das Thema
«Wohnen im Alter» im Zentrum
stand, widmet sich der zweite
Teil dem Recht auf Gesundheit
und Bewegungsfreiheit.
Recht auf Gesundheit
Auch wenn in Artikel 41 der Bundesverfassung
festgehalten ist,
dass jede Person von Bund und
Kanton die für ihre Gesundheit
notwendige Pflege erhält, ist das
Recht auf Gesundheit in der
Schweiz nicht als einklagbares
Grundrecht anerkannt. Die Bundesverfassung
nennt die angemessene
Gesundheitsversorgung
aber als Sozialziel und verpflichtet
Bund und Kantone, sich dafür
einzusetzen.
Wichtigstes Instrument in diesem
Zusammenhang ist die obligato-
rische Krankenversicherung,
welche Menschen im Krankheitsfall
finanziell absichern soll.
Die Krankenversicherung gewährt
keinen kostenlosen Anspruch auf
medizinische Leistungen. Die Versicherten
müssen sich einerseits
an den allgemeinen Kosten des
Gesundheitswesens beteiligen, sei
dies über die Krankenkassenprämien
oder die Steuern. Andererseits
müssen sie auch die einzelnen
Leistungen, die sie beziehen,
mitfinanzieren.
Die Krankenversicherung übernimmt
auch nicht jede von Versicherten
gewünschte Leistung. Sie
zahlt nur Leistungen, die wirksam,
zweckmässig und wirtschaftlich
sind. Für die Beurteilung der Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit kann das Alter
als Kriterium herangezogen werden.
Versicherte Personen können frei
wählen, von welcher Ärztin bzw.
von welchem Arzt oder in welchem
Spital sie sich behandeln
lassen möchten. Da jedoch in der
Regel nur die Kosten, die am
Wohn- oder Arbeitsort üblich sind,
übernommen werden, ist die
Wahlfreiheit für Personen mit tiefem
Einkommen faktisch eingeschränkt.
Die freie Arztwahl ist
auch in Alters- und Pflegeheimen
geschützt, Abweichungen sind
nur aus triftigen Gründen zulässig.
Wirtschaftliche und organisatorische
Gründe, zum Beispiel um die
Kommunikation zwischen Pflege
und ärztlichem Personal zu erleichtern,
genügen nicht.
Bewegungsfreiheit
Die Bewegungsfreiheit garantiert
das Recht, sich frei fortzubewegen.
Sie wird durch die Verwendung
mechanischer (z.B. Zewi-
Decken, Bettgitter, die Fixation
von Hand oder Fussgelenken, das
Abschliessen von Türen), medizinischer
(z.B. Beruhigungsspritzen)
oder elektronischer Mittel (z.B.
Überwachungskameras, Lichtmelder,
GPS-Sender, Matratzensensoren)
tangiert.
Die Bewegungsfreiheit kann nicht
nur durch aktives, sondern auch
durch passives Verhalten verletzt
werden, etwa wenn einer hilfsbedürftigen
Person ein Hilfsmittel,
wie zum Beispiel ein Rollator oder
ein Rollstuhl, verweigert wird.
Deshalb ist es problematisch, dass
die Hilfsmittelliste der AHV sehr
viel eingeschränkter ist als diejenige
der IV.
Schliesslich kann die Bewegungsfreiheit
auch beeinträchtigt sein,
wenn bauliche Massnahmen wie
Treppengeländer oder Rollstuhlrampen
unterbleiben, welche es
älteren Menschen ermöglichen
würden, sich unbehindert fortzubewegen.
Zentral in diesem Zusammenhang
ist das Behindertengleichstellungsgesetz
(BehiG).
Es verpflichtet Bund, Kantone und
Gemeinden, Hindernisse für die
Mobilität laufend abzubauen.
Die Infrastruktur und die Fahrzeuge
der Schweizer Transportunternehmen
müssen beispielsweise
bis Ende 2023 barrierefrei sein.
Aktuell entsprechen erst 35 Prozent
der Bahnhöfe, über die allerdings
64 Prozent der Passagiere
reisen, den gesetzlichen Anforderungen.