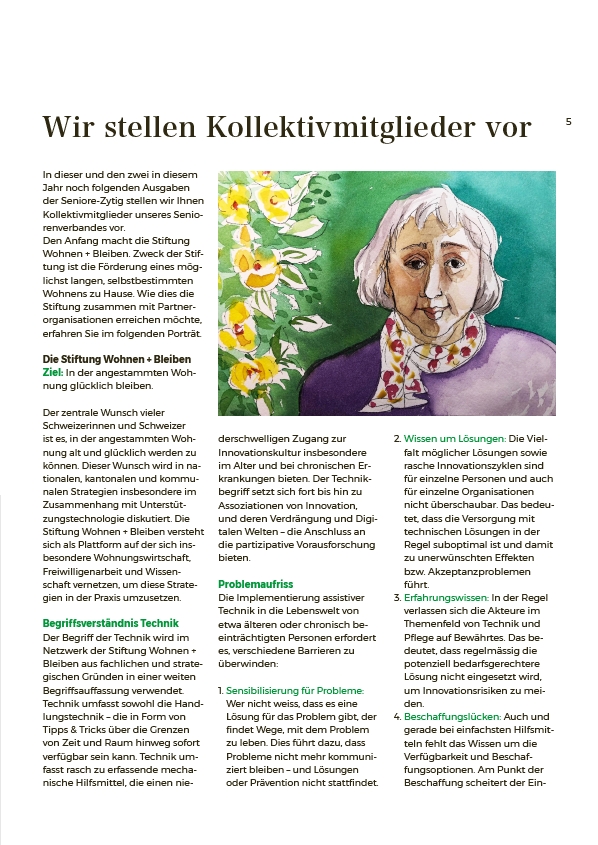
5
Wir stellen Kollektivmitglieder vor
In dieser und den zwei in diesem
Jahr noch folgenden Ausgaben
der Seniore-Zytig stellen wir Ihnen
Kollektivmitglieder unseres Seniorenverbandes
vor.
Den Anfang macht die Stiftung
Wohnen + Bleiben. Zweck der Stiftung
ist die Förderung eines möglichst
langen, selbstbestimmten
Wohnens zu Hause. Wie dies die
Stiftung zusammen mit Partnerorganisationen
erreichen möchte,
erfahren Sie im folgenden Porträt.
Die Stiftung Wohnen + Bleiben
Ziel: In der angestammten Wohnung
glücklich bleiben.
Der zentrale Wunsch vieler
Schweizerinnen und Schweizer
ist es, in der angestammten Wohnung
alt und glücklich werden zu
können. Dieser Wunsch wird in nationalen,
kantonalen und kommunalen
Strategien insbesondere im
Zusammenhang mit Unterstützungstechnologie
diskutiert. Die
Stiftung Wohnen + Bleiben versteht
sich als Plattform auf der sich insbesondere
Wohnungswirtschaft,
Freiwilligenarbeit und Wissenschaft
vernetzen, um diese Strategien
in der Praxis umzusetzen.
Begriffsverständnis Technik
Der Begriff der Technik wird im
Netzwerk der Stiftung Wohnen +
Bleiben aus fachlichen und strategischen
Gründen in einer weiten
Begriffsauffassung verwendet.
Technik umfasst sowohl die Handlungstechnik
– die in Form von
Tipps & Tricks über die Grenzen
von Zeit und Raum hinweg sofort
verfügbar sein kann. Technik umfasst
rasch zu erfassende mechanische
Hilfsmittel, die einen niederschwelligen
Zugang zur
Innovationskultur insbesondere
im Alter und bei chronischen Erkrankungen
bieten. Der Technikbegriff
setzt sich fort bis hin zu
Assoziationen von Innovation,
und deren Verdrängung und Digitalen
Welten – die Anschluss an
die partizipative Vorausforschung
bieten.
Problemaufriss
Die Implementierung assistiver
Technik in die Lebenswelt von
etwa älteren oder chronisch beeinträchtigten
Personen erfordert
es, verschiedene Barrieren zu
überwinden:
1. Sensibilisierung für Probleme:
Wer nicht weiss, dass es eine
Lösung für das Problem gibt, der
findet Wege, mit dem Problem
zu leben. Dies führt dazu, dass
Probleme nicht mehr kommuniziert
bleiben – und Lösungen
oder Prävention nicht stattfindet.
2. Wissen um Lösungen: Die Vielfalt
möglicher Lösungen sowie
rasche Innovationszyklen sind
für einzelne Personen und auch
für einzelne Organisationen
nicht überschaubar. Das bedeutet,
dass die Versorgung mit
technischen Lösungen in der
Regel suboptimal ist und damit
zu unerwünschten Effekten
bzw. Akzeptanzproblemen
führt.
3. Erfahrungswissen: In der Regel
verlassen sich die Akteure im
Themenfeld von Technik und
Pflege auf Bewährtes. Das bedeutet,
dass regelmässig die
potenziell bedarfsgerechtere
Lösung nicht eingesetzt wird,
um Innovationsrisiken zu meiden.
4. Beschaffungslücken: Auch und
gerade bei einfachsten Hilfsmitteln
fehlt das Wissen um die
Verfügbarkeit und Beschaffungsoptionen.
Am Punkt der
Beschaffung scheitert der Ein-