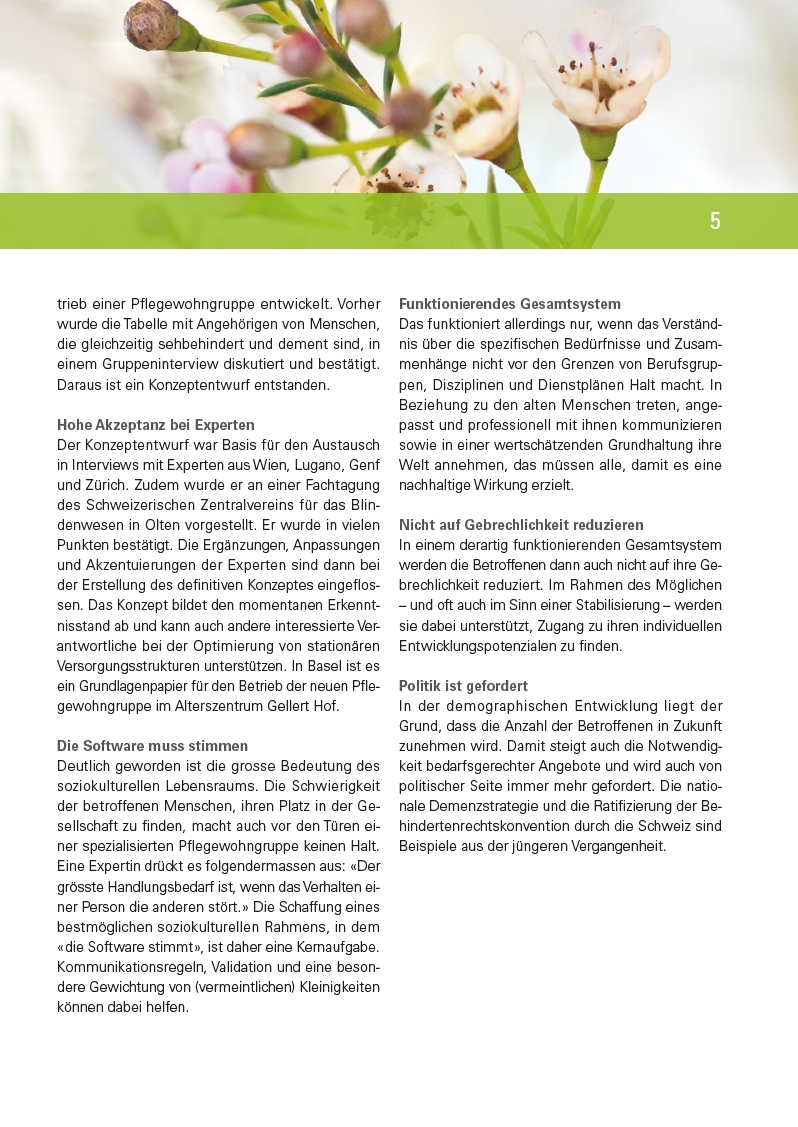
5
trieb einer P egewohngruppe entwickelt. Vorher
wurde die Tabelle mit Angehörigen von Menschen,
die gleichzeitig sehbehindert und dement sind, in
einem Gruppeninterview diskutiert und bestätigt.
Daraus ist ein Konzeptentwurf entstanden.
Hohe Akzeptanz bei Experten
Der Konzeptentwurf war Basis für den Austausch
in Interviews mit Experten aus Wien, Lugano, Genf
und Zürich. Zudem wurde er an einer Fachtagung
des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen
in Olten vorgestellt. Er wurde in vielen
Punkten bestätigt. Die Ergänzungen, Anpassungen
und Akzentuierungen der Experten sind dann bei
der Erstellung des de nitiven Konzeptes einge ossen.
Das Konzept bildet den momentanen Erkenntnisstand
ab und kann auch andere interessierte Verantwortliche
bei der Optimierung von stationären
Versorgungsstrukturen unterstützen. In Basel ist es
ein Grundlagenpapier für den Betrieb der neuen P egewohngruppe
im Alterszentrum Gellert Hof.
Die Software muss stimmen
Deutlich geworden ist die grosse Bedeutung des
soziokulturellen Lebensraums. Die Schwierigkeit
der betroffenen Menschen, ihren Platz in der Gesellschaft
zu nden, macht auch vor den Türen einer
spezialisierten P egewohngruppe keinen Halt.
Eine Expertin drückt es folgendermassen aus: «Der
grösste Handlungsbedarf ist, wenn das Verhalten einer
Person die anderen stört.» Die Schaffung eines
bestmöglichen soziokulturellen Rahmens, in dem
«die Software stimmt», ist daher eine Kernaufgabe.
Kommunikationsregeln, Validation und eine besondere
Gewichtung von (vermeintlichen) Kleinigkeiten
können dabei helfen.
Funktionierendes Gesamtsystem
Das funktioniert allerdings nur, wenn das Verständnis
über die spezi schen Bedürfnisse und Zusammenhänge
nicht vor den Grenzen von Berufsgruppen,
Disziplinen und Dienstplänen Halt macht. In
Beziehung zu den alten Menschen treten, angepasst
und professionell mit ihnen kommunizieren
sowie in einer wertschätzenden Grundhaltung ihre
Welt annehmen, das müssen alle, damit es eine
nachhaltige Wirkung erzielt.
Nicht auf Gebrechlichkeit reduzieren
In einem derartig funktionierenden Gesamtsystem
werden die Betroffenen dann auch nicht auf ihre Gebrechlichkeit
reduziert. Im Rahmen des Möglichen
– und oft auch im Sinn einer Stabilisierung – werden
sie dabei unterstützt, Zugang zu ihren individuellen
Entwicklungspotenzialen zu nden.
Politik ist gefordert
In der demographischen Entwicklung liegt der
Grund, dass die Anzahl der Betroffenen in Zukunft
zunehmen wird. Damit steigt auch die Notwendigkeit
bedarfsgerechter Angebote und wird auch von
politischer Seite immer mehr gefordert. Die nationale
Demenzstrategie und die Rati zierung der Behindertenrechtskonvention
durch die Schweiz sind
Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit.