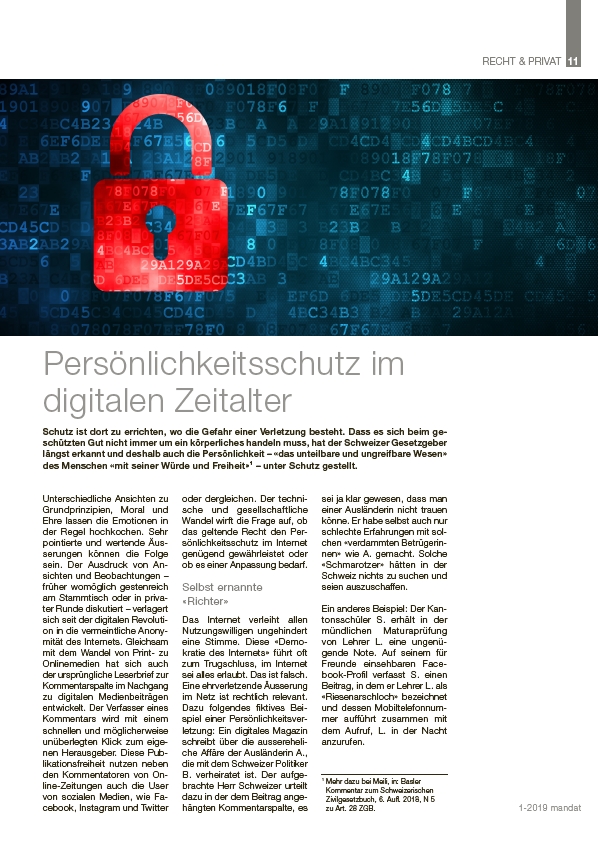
11
RECHT & PRIVAT
1-2019 mandat
Persönlichkeitsschutz im
digitalen Zeitalter
Schutz ist dort zu errichten, wo die Gefahr einer Verletzung besteht. Dass es sich beim geschützten
Gut nicht immer um ein körperliches handeln muss, hat der Schweizer Gesetzgeber
längst erkannt und deshalb auch die Persönlichkeit – «das unteilbare und ungreifbare Wesen»
des Menschen «mit seiner Würde und Freiheit»1 – unter Schutz gestellt.
Unterschiedliche Ansichten zu
Grundprinzipien, Moral und
Ehre lassen die Emotionen in
der Regel hochkochen. Sehr
pointierte und wertende Äusserungen
können die Folge
sein. Der Ausdruck von Ansichten
und Beobachtungen –
früher womöglich gestenreich
am Stammtisch oder in privater
Runde diskutiert – verlagert
sich seit der digitalen Revolution
in die vermeintliche Anonymität
des Internets. Gleichsam
mit dem Wandel von Print- zu
Onlinemedien hat sich auch
der ursprüngliche Leserbrief zur
Kommentarspalte im Nachgang
zu digitalen Medienbeiträgen
entwickelt. Der Verfasser eines
Kommentars wird mit einem
schnellen und möglicherweise
unüberlegten Klick zum eigenen
Herausgeber. Diese Publikationsfreiheit
nutzen neben
den Kommentatoren von Online
Zeitungen auch die User
von sozialen Medien, wie Facebook,
Instagram und Twitter
oder dergleichen. Der technische
und gesellschaftliche
Wandel wirft die Frage auf, ob
das geltende Recht den Persönlichkeitsschutz
im Internet
genügend gewährleistet oder
ob es einer Anpassung bedarf.
Selbst ernannte
«Richter»
Das Internet verleiht allen
Nutzungswilligen ungehindert
eine Stimme. Diese «Demokratie
des Internets» führt oft
zum Trugschluss, im Internet
sei alles erlaubt. Das ist falsch.
Eine ehrverletzende Äusserung
im Netz ist rechtlich relevant.
Dazu folgendes fiktives Beispiel
einer Persönlichkeitsverletzung:
Ein digitales Magazin
schreibt über die aussereheliche
Affäre der Ausländerin A.,
die mit dem Schweizer Politiker
B. verheiratet ist. Der aufgebrachte
Herr Schweizer urteilt
dazu in der dem Beitrag angehängten
Kommentarspalte, es
sei ja klar gewesen, dass man
einer Ausländerin nicht trauen
könne. Er habe selbst auch nur
schlechte Erfahrungen mit solchen
«verdammten Betrügerinnen
» wie A. gemacht. Solche
«Schmarotzer» hätten in der
Schweiz nichts zu suchen und
seien auszuschaffen.
Ein anderes Beispiel: Der Kantonsschüler
S. erhält in der
mündlichen Maturaprüfung
von Lehrer L. eine ungenügende
Note. Auf seinem für
Freunde einsehbaren Facebook
Profil verfasst S. einen
Beitrag, in dem er Lehrer L. als
«Riesenarschloch» bezeichnet
und dessen Mobiltelefonnummer
aufführt zusammen mit
dem Aufruf, L. in der Nacht
anzurufen.
1 Mehr dazu bei Meili, in: Basler
Kommentar zum Schweizerischen
Zivilgesetzbuch, 6. Aufl. 2018, N 5
zu Art. 28 ZGB.